Vor 80 Jahren – 1945 die Stunde Null?
16. Apr.. 2025 / Wissenschaft & Forschung
Vor 80 Jahren – die Stunde Null in der Adventgemeinde in Deutschland?
Das Ende des Zweiten Weltkrieges stellt die vielleicht größte Zäsur in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts dar. Die Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands in Reims und wenig später am 8. Mai in Berlin-Karlshorst wird heute als Tag der Befreiung bezeichnet. Damals freilich erlebten viele Deutsche das ganz anders. Geprägt von der NS-Propaganda glaubten manche immer noch an den Endsieg und wollten die Niederlage nicht wahrhaben. Eine Welt brach zusammen, Träume waren ausgeträumt, fast das ganze Land lag in Schutt und Asche. Unzählige Menschen hatten ihre Heimat verloren, Flüchtlingstrecks quälten sich über die Straßen, Zwangsarbeiter genossen die wiedergewonnene Freiheit und zogen teils plündernd durchs zerschundene Land. Sie alle wurden als DP (displaced persons) bezeichnet. Genau das trifft eigentlich auf die gesamte deutsche Bevölkerung zu: displaced – entwurzelt.
In der Retrospektive wird gern bemerkt, dass das Schuldbekenntnis der Evangelischen Landeskirchen, die Stuttgarter Schulderklärung vom 19. Oktober 1945, ein Lichtblick in dunkler Zeit und der Beginn eines Aufarbeitungsprozesses war. Heute wissen wir, dass diese Erklärung nur auf den Druck der Ökumenevertreter zustande kam, die alle Hilfslieferungen (Care-Pakete) für die Kirchen von einer solchen Erklärung abhängig gemacht hatten. Es brauchte einfach Zeit, den Schock des Kriegsendes zu überwinden.
Und in der Adventgemeinde? Bereits am Sabbat, dem 21. April 1945, traf der amerikanische Militärarzt MacAlpine auf der Suche nach Adventisten im stark zerstörten Frankfurt am Main den Vorsteher der Mittelrheinischen Vereinigung Albert Sachsenmeyer. Nach dem Gespräch, bei dem sich beide über die Lage der Gemeindemitglieder und über die Situation der Gemeinschaft in Deutschland austauschten, verfasste Sachsenmeyer, der Bitte MacAlpines folgend, für die Generalkonferenz einen Bericht über die Gemeinschaft der STA in Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt fanden im Norden, im Osten und im Süden Deutschlands noch Kampfhandlungen statt. Genau zwei Wochen später, am 5. Mai, zogen vormittags sowjetische Kampftruppen in Friedensau ein, drei Tage vor der Kapitulation.
Nachdem der Krieg ein Ende gefunden hatte, konnte eine erste Bilanz gezogen werden: Der Sitz der Mitteleuropäischen Division in Berlin war zerstört, ein Ausweichbüro war schon seit 1942 in Friedensau eingerichtet worden. Alle drei Verbände standen vor den Trümmern ihrer Verwaltungssitze, in den meisten Vereinigungen sah es nicht anders aus. Tausende adventistische Soldaten waren gefallen, viele Gemeindeglieder – vor allem in den Großstädten hatten ihre Wohnungen verloren. Bei den Gemeindesälen sah die Bilanz nicht besser aus, viele waren bereits im Krieg beschlagnahmt worden und, wenn nicht zerstört, so doch für gottesdienstliche Zwecke im Moment kaum nutzbar. Das größte Problem lag aber in den vielen Flüchtlingen, die damals aus Ost- und Westpreußen, aus Schlesien, dem Sudetenland und anderen Gebieten Osteuropas vertrieben wurden und eine neue Heimat suchten. Sie fanden wahrlich nicht immer in ihren Gemeinden eine offene Aufnahme. Erst Jahrzehnte später berichteten einige über die Ablehnung, die ihnen in ihrer Not entgegenschlug.
Hier lag in den ersten Monaten nach Kriegsende die größte Aufgabe. Es galt, viele Gemeinden neu zu organisieren, eine Verwaltungsstruktur herzustellen, Hilfslieferungen aus den Vereinigten Staaten und Nordeuropa zu verteilen und bei dem großen Mangel an Predigern das Gemeindeleben zu sichern. Da das Verlagsgebäude in Hamburg zerstört war und die britischen Behörden mit Druckgenehmigungen sehr zurückhaltend umgingen, konnte das Gemeindeblatt, der „Adventbote“, nicht erscheinen. Anders in Süddeutschland: Durch Vermittlung eines amerikanischen adventistischen Offiziers konnte bereits im Sommer 1945 in München eine eigene Zeitschrift „Der Botschafter“ erscheinen.
Das war auch dringend notwendig, denn die Krisenzeit brachte viele Menschen in die Kirchen, sicher manche auch wegen der begehrten Hilfspakete. Überall suchten Menschen in schwerer Zeit Hilfe und Sicherheit. Es war eine Zeit der Evangelisationen und Taufen. Hier lag in den nächsten fünf bis sieben Jahren das Hauptaugenmerkt der Kirchenleitung. Die Gemeinden wuchsen, es wurde viel gesungen, viel Zeit miteinander verbracht. An eine Aufarbeitung des Vergangenen dachte fast niemand. Das schien der damaligen Situation nicht angepasst.
Trotzdem gab es einzelne Stimmen, die Verantwortung für das Vergangene spürten. Teilnehmer der Wiedereröffnung Friedensaus am 5. Juli 1947 erinnerten sich, dass der alte und neue Divisionsvorsteher Adolf Minck in seinem Weihegebet „zum Ausdruck brachte, dass wir als deutsche STA schuldig geworden seien“. Andere kamen nicht zu dieser Beurteilung, sondern übernahmen eine Metapher, die bereits Albert Sachsenmeyer in seinem Bericht an die Generalkonferenz im April 1945 gebraucht hatte: „Nur dank der Gnade Gottes und der Tatsache, dass er den führenden Brüdern seine Hilfe nicht verweigerte oder vorenthielt, existiert unsere Gemeinschaft in Deutschland noch immer wie ein starker Baum, wenn auch vom Sturm gebeugt und stark bewegt.“ Eine solche Sicht machte ein Verständnis für die Notwendigkeit einer Aufarbeitung der NS-Zeit für Jahrzehnte überflüssig.
Dass es damals – mit einiger zeitlicher Verzögerung – doch noch zu einer, aus heutiger Sicht teils verunglückten Aufarbeitung kam, schulden wir dem Schweigen der deutschen Verantwortungsträger und den Berichten amerikanischer adventistischer Offiziere, die in leitender Stellung in der amerikanischen Militärverwaltung Berlins Verantwortung trugen. Ihre Berichte formten ein Bild, das verständlicherweise einseitig bleiben musste. Wegen fehlender Postverbindungen und Reisegenehmigungen innerhalb Deutschlands und ins Ausland entstanden so Missverständnisse, die einem geordneten notwendigen Neuanfang entgegenstanden. Dazu kamen theologische Fragen. Adventisten hatten sich in der Vergangenheit so gut wie keine staatsethischen Gedanken gemacht. Ihr Blick ging nach vorn zur Wiederkunft und dem entsprechenden prophetischen Rahmen, dem weit mehr Beachtung geschenkt wurde als den fundamentalen politischen Umwälzungen weltweit seit dem Ende des Ersten Weltkrieges und vor allem der Diktatur in Deutschland seit 1933.
Erst im Februar 1947 nahm GK-Präsident James L. McElhany direkt Kontakt mit dem Vorsteher der Mitteleuropäischen Division Adolf Minck auf. Zwei Monate später sandte er ein Schreiben mit einer Reihe von Fragen zum Verhalten deutscher STA während der NS-Zeit. Hier hätte eine direkte Konsultation beginnen müssen, denn die aufgeworfenen Fragen, zum Beispiel im Blick auf die Sabbatheiligung, brannten auch vielen Gemeindegliedern in Deutschland unter den Nägeln. Doch erst Monate später folgte die Antwort. Sie konnte die Verantwortungsträger der Generalkonferenz nicht überzeugen, zumal Deutschland seit der Demission von Ludwig Richard Conradi 1932 unter Generalverdacht stand. Diese Vermutung allerdings untergrub eine wirkliche Auseinandersetzung und einen Lernprozess über das Verhalten von Adventisten in autoritären Regimes. Das sollte sich später in anderen Ländern der Welt bitter rächen. Erst 1952 nahmen Vertreter der Mitteleuropäischen Division an den damals noch häufiger stattfindenden Generalkonferenzen statt. Hier kam es zu einer Neubesetzung der Divisionsleitung – eine verspätete Stunde Null (Dr. Johannes Hartlapp).
Zitate aus: Johannes Hartlapp: Siebenten-Tags-Adventisten im Nationalsozialismus. Göttingen: V & R unipress, 2008, 605 und 478.
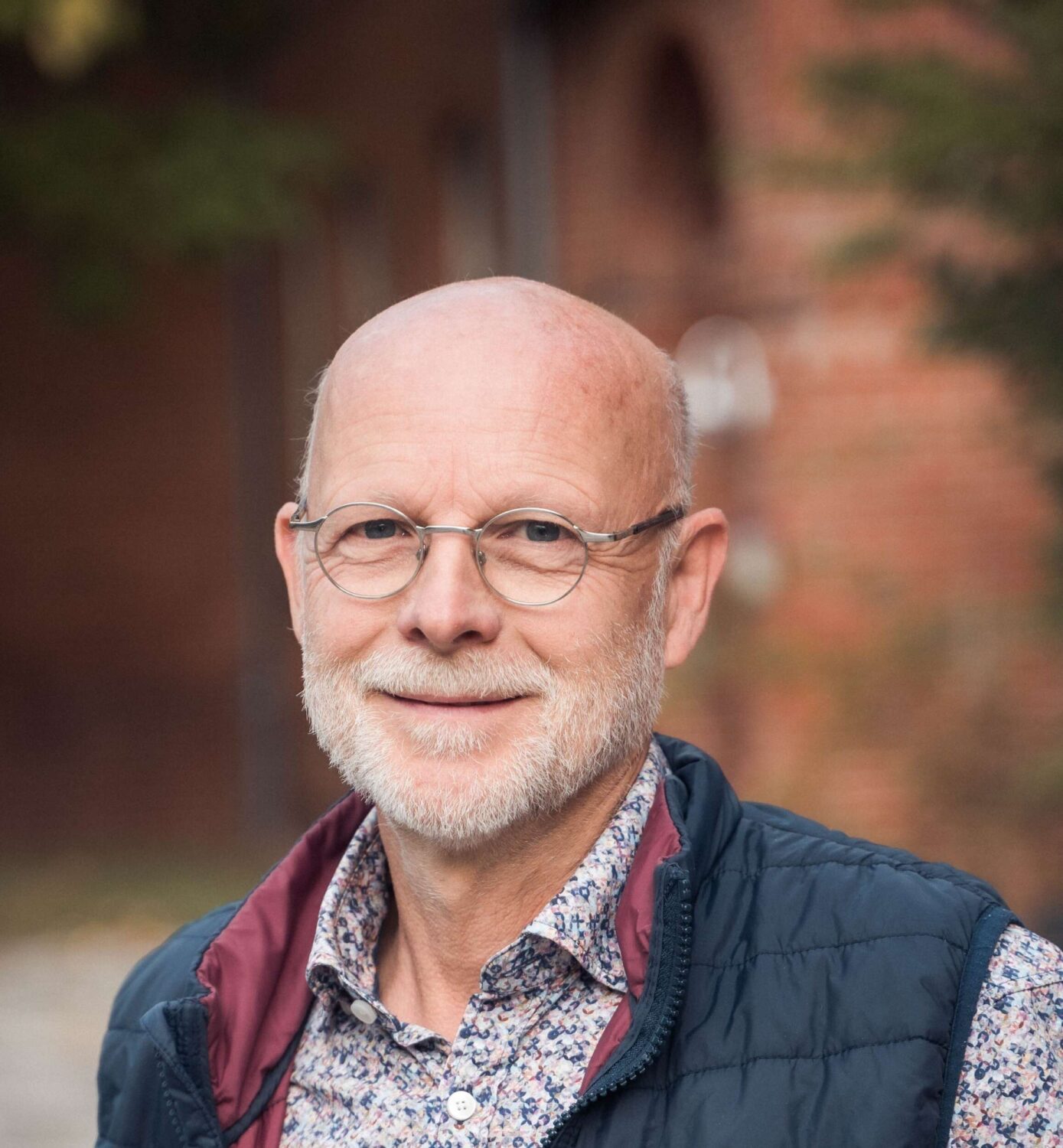
Bildrechte: Theologische Hochschule Friedensau | Michael Bistrovich

Bildrechte: Archiv | Johannes Hartlapp

Bildrechte: Archiv | Johannes Hartlapp

Bildrechte: Archiv | Johannes Hartlapp